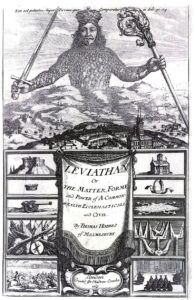Two roads diverge in a wood
Manchmal gabelt sich das Leben – und dann muss man sich entscheiden. Ob das jetzt der Beruf ist, für den man fünf Jahre studiert hat, ob es doch nochmal an die Uni geht oder ob das jetzt der Partner fürs Leben ist. Wer möchte schon am Ende reumütig zurückblicken und sich denken – hätte ich mich damals doch anders entschieden.
Um die Limbostange des Lebens noch ein bisschen tiefer zu hängen, kommen solche Entscheidungen natürlich gleich im halben Dutzend. Die Reaktion ist wohlvertraut, ist sie doch mit dem Paradoxon vergleichbar, bei extrem vielen Aufgaben gar nichts mehr zu tun: Entscheidungsverweigerung.
Es hilft alles nichts – die Entscheidung muss gefällt werden.
And I, I took the road less travelled by
Vielleicht haben die Amerikaner den Poeten Robert Frost deshalb als Nationalikone auserwählt, weil er sie kollektiv von diesem Entscheidungsdilemma befreit. Vielleicht auch, weil er mit einer Klarheit und Eindringlichkeit uramerikanische Werte zu vermitteln vermag wie kein Anderer. In seinem Gedicht The Road not Taken aus dem Mountain Interval schreibt er:
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
Man kann sich ihn gut vorstellen, wie er seufzend erzählt, dass er vor dieser Weggabelung stand und den riskanteren Weg wählte. Und genau diese eine Entscheidung, den weniger begangenen Weg zu wählen, hat den Unterschied gemacht. Er selbst, durch seine Entscheidung, machte den Unterschied.
Es ist eine Offenbarung, die besagt, dass du für dein eigenes Leben verantwortlich bist. Implizit begründet dieses Gedicht eine Entscheidungsschwere und Ergebniskompromisslosigkeit, die bis heute meist falsch gedeutet werden. Sie stehen im direkten Gegensatz zum Schicksal, jener vom Katholizismus geprägten europäischen Auffassung von Entscheidungsfähigkeit. Das Gedicht dagegen ist ein Manifest des Individuums und eine Ode an den Pioniergeist. Darüber hinaus ist es eine Blaupause der Entscheidungsfindung.
And that has made all the difference
Aber Frost ist keinesfalls der Einzige mit einem Beitrag zur menschlichen Entscheidungsfindung. Weniger poetisch, aber genauso unterhaltsam ist Daniel Kahneman – Psychologe, Nobelpreisträger für Ökonomie und emeritierter Berkeley-Professor. In seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denkenfasst er die Ergebnisse seiner gemeinsam mit Amos Tversky durchgeführten Forschungen zusammen. Seinen Wirtschaftsnobelpreis erhielt er jedoch für die Modellierung menschlicher Entscheidungsfindung. Seine Errungenschaft ist eine Theorie, die über den sogenannten homo oeconomicus hinausgeht. Dieses Einhorn ordoliberaler Ammenmärchen geht davon aus, dass jeder immer rational handelt. Jeder. Immer. Die britische Wirtschaftszeitung The Economist bezeichnet den homo oeconomicus deshalb auch gerne als Mr. Spock der Entscheidungstheorie.
Die einen wenden jetzt ein, dass sie überraschenderweise Menschen kennen, die manchmal nicht rational handeln, die Nerds unter uns weisen darauf hin, dass Mr. Spock nun mal kein Mensch sei. Eines dieser beiden Argumente muss Herrn Kahneman dazu veranlasst haben, sich auf die Suche nach einer neuen Erwartungstheorie zu machen. Was er fand, basierte auf dem alten Muster, wurde jedoch um eine lange Liste von so genannten kognitiven Verzerrungen ergänzt. Kahnemans Vorstellung, wie wir Entscheidungen treffen, ist also im Grunde vergleichbar mit der französischen Sprache – eigentlich logisch aufgebaut, aber mit so vielen Ausnahmen gespickt, dass die Regel zur Ausnahme wird.
Diese Ausnahmen, also kognitive Verzerrungen, sind hochspannend. Sie zerfurchen unseren Entscheidungsprozess bis zur Unkenntlichkeit. Das passt jedoch überhaupt nicht ins Bild von Robert Frosts Gedicht – belügt sich der Protagonist selber, wenn er sagt, dass seine Handlungen den Unterschied gemacht haben?
Ja, wenn es nach Kahneman geht. Und bereits mit einfachen Experimenten [http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo] lässt sich zeigen, wie erschreckend manipulierbar [http://www.youtube.com/watch?v=4-HxtKgKrL8] unsere Wahrnehmung ist. Unser Gehirn ist eine Sinngebungsmaschine: Damit es ins Bild (dem eigenen, der sozialen Erwünschtheit, der Erwartungshaltung) passt, verdrängt, verbiegt oder verändert unser Gehirn hemmungslos Tatsachen. Kahneman bringt das etwas nüchterner auf den Punkt:
Die Sinngebungsmaschinerie von System I lässt uns die Welt geordneter, einfacher, vorhersagbarer und kohärenter sehen, als sie tatsächlich ist. Die Illusion, man habe die Vergangenheit verstanden, nährt die weitere Illusion, man könne die Zukunft vorhersagen und kontrollieren. Diese Illusionen sind beruhigend. Sie verringern die Angst, die wir zu spüren bekämen, wenn wir uns die Ungewissheiten des Daseins uneingeschränkt bewusst machen würden. (Kahneman, S. 254)
Diese Illusionen der Entscheidungskompetenz und des Verstehens beeinflussen menschliches Handeln in allen Bereichen. Und das nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Über Jahre hinweg nutzte Nassim Taleb diese Erkenntnisse, um an der Börse die kognitiven Verzerrungen der Akteure gegeneinander auszuspielen. Er erkannte, dass extrem seltene Ereignisse, er nannte sie zu Ehren Karl Poppers „schwarze Schwäne“, häufiger auftreten mussten als bisher angenommen. Dies bewies er eben jener Zunft, die traditionell an das Einhorn des homo oeconomicus glaubte. Taleb forscht nicht nur weiterhin zu Risiken durch kognitive Verzerrung, sondern hat mit seinen Börsenaktivitäten über Jahre hinweg ein Vermögen erwirtschaftet.
Both needed wear
Auf einmal wirkt also der gute Robert Frost ein wenig naiv. Aber der Eindruck täuscht, denn es ist entscheidend, welchen Auszug des Gedichts man wählt. Vor der im zweiten Abschnitt erwähnten Passage schreibt er:
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
Das ist unglaublich. Er beschreibt, wie er vorher zaudernd vor dieser Weggabelung steht und beide Straßen eigentlich gleich sind. Mehr noch, sie sind sogar gleich begangen. Ein paar Abschnitte weiter erzählt er dann heroisch, wie er den Unterschied machte, als er die weniger begangene Straße wählte. Er schafft es innerhalb eines Gedichtes, uns so sehr über den Tisch zu ziehen, dass wir die Reibung als Nestwärme wahrnehmen. Dieser alte Herr mit seiner klaren, sehr direkten Sprache, der Assoziation mit New Hampshire und der Affirmation traditioneller Werte hält uns vor Augen, wie sehr wir seinem kognitiven Bias unterlegen sind. Und das Schlimme ist – er klärt uns noch nicht mal auf.
In Amerika gilt Robert Frost weiterhin als Vertreter reiner, gutartiger amerikanischer Wertvorstellungen. Seine Werke sind Standardstoff jeder Highschool, wie es Goethes in Deutschland sind. Niemand gewann häufiger den Pulitzer Prize. Robert Frost ist einer von Amerikas raren „öffentlichen literarischen Personen, fast schon eine künstlerische Institution“. In der Literaturforschung ist die Einordnung des Dichters Robert Frost jedoch nicht einheitlich. In einer sehr empfehlenswerten Vorlesung widmet sich beispielsweise Kevin Murphy, Professor am Englischkolleg der Ithaca University, The Road not Taken.
Abschließend ist eine Anekdote zum 85. Geburtstags Robert Frosts zu erwähnen. Zu Frosts Ehren wurde der Literaturkritiker Lionel Trilling gebeten eine Rede zu halten. Er schockierte die Anwesenden mit dem Geständnis, dass er Frosts Gedichte erst kürzlich für ihre leicht zu übersehende Grimmigkeit zu schätzen gelernt hatte. Über Frost sagte er: „I regard Robert Frost as a terrifying poet“.
Trilling musste sich aufgrund der allgemeinen Erbostheit für seine Aussagen entschuldigen. Frost jedoch nahm es ihm jedenfalls nicht übel: „
Not distressed at all. […] You made my birthday a surprise party”, schrieb er und fügte hinzu: „No sweeter music can come to my ears than the clash of arms over my dead body when I am down.”
The road we should take
Wenn Frost aber diese Ambivalenz seines Gedichtes bewusst wählte, was will er uns dann vermitteln? Versucht er uns mit diesem Gedicht eine neue Maxime nahe zu legen, frei nach dem Motto: „Handle, als wenn es nur auf dich ankäme, aber wisse, dass dem nicht so ist“? Oder hat er uns einfach einen Streich gespielt?
Im richtigen Moment mal was wagen. Den Sinn für die Tragweite der Entscheidung schärfen. Man stellt sich den alten Frost vor, wie er im Schaukelstuhl sitzt, kurz die Pfeife aus dem Mundwinkel nimmt und dir zuraunt: „Junge (oder Mädchen), hier geht es um dein Leben, also nimm es gefälligst selbst in die Hand.“ Hätten meine Vorfahren mal Frost gelesen, sie wären vielleicht nicht über ein halbes Jahrtausend im selben Dorf geblieben. Hier ist die Maxime also durchaus angebracht.
Wenn sich dein ganzer Lebensweg etwa zehn Mal gabelt, ist es schwer Einzelentscheidungen überzubewerten. Wenn aber schon der Kaffeekauf als Manifest der eigenen Charakterausprägung dienen soll, wird Roberts kleiner Streich zum handfesten Problem. Dann habe ich bei jeder Entscheidung das Gefühl, vor einer Weggabelung zu stehen. In dem Moment wird die Fülle von Optionen zur Belastung. Und Entscheidungen zur Paralyse, je mehr sie auf mich einprasseln.
Mit dieser Strategie des bloß-nichts-falsch-Machens sind wir denkbar schlecht aufgestellt. Unsere Welt ist nicht mehr das Dorf der linearen Wirkungszusammenhänge und begrenzten Optionen. Informationen, Möglichkeiten und Komplexität explodieren um uns herum wie Seerosen im Hochsommer. Jede Option einzeln zu bewerten, abzuwägen und erst dann zu entscheiden würde uns maßlos überfordern. Unser Entscheidungsvermögen ist leider mehr ein Gartentümpel als das Mittelmeer.
Was nachhaltig hilft, ist ein angestaubter Bekannter – das Prinzip. Einmal festgelegt, ist es wie der Lieblingsfußballverein, den wechselt man nicht. Manche nennen das auch einfach Haltung. Jetzt sollen ja gerade wir diese Haltung verloren haben. Wie nasse Säcke hängen wir als Generation Y zwischen den Optionen fest und wissen nicht, welches Praktikum, welche Stadt, welches Lebensmodell. Aber ganz ehrlich – wer mit 25 schon weiß, wie sein Leben verläuft, hat wahrscheinlich eine Bankausbildung gemacht. Und die Menschen mit wirklichen Multioptionalitätsproblematiken sitzen woanders.
Lassen wir diese Robert-Frost-Überschriften und kommen wir zum Eingemachten
Die Herren Black & Scholes haben es eindrucksvoll gezeigt: Optionen kosten Geld. Und zwar mehr, umso volatiler das Umfeld ist, je länger Optionen gehalten werden und je mehr man davon hat. Die Kosten lassen sich sogar ziemlich gut berechnen. Und für die Berechnungsformel des spezifischen Optionspreises gab es dann ebenfalls einen Nobelpreis.
Optionen gibt es nicht nur an der Börse, sondern auch in der Politik, in der Wirtschaft und im Privaten. Letzteres kennen wir aus den Ferien nach dem Studium/Abi, die wir nicht mit unseren Freunden verbracht haben, sondern auf der Suche nach dem möglichst perfekten Arbeitgeber. Oder wenn der Schwarm keinen Bock mehr hatte, weil man sich einfach nicht entscheiden konnte. Oder wenn wir charakterlich so vage bleiben, dass Partygespräche zum Konsumvergleich verkommen. Wir wollen uns nicht festlegen oder unsere Optionen erweitern, und dafür zahlen wir selber den Preis.
Das ist in der Politik anders. Hier ist der Politiker nur Agent für seine Wähler und idealerweise auch für die Menschen, die von seiner Politik betroffen sind. Die Konsequenzen seiner Handlung bekommt er nur indirekt zu spüren. Die Kosten für Optionen trägt also jemand anders. Das ist kritisch, denn es liefert einen Anreiz, sich Optionen zu bedienen und die Kosten an die Allgemeinheit auszulagern.
Politische Optionen so lange wie möglich zu halten scheint jedoch gerade die Krankheit der jetzigen deutschen Bundesregierung zu sein. Verzögern, aussitzen, ablenken und umschwenken sind ihre Symptome. Die Behandlung der eigenen Minister, die Eurokrise und die Energiewende sind ihre Krankenakten.
Wir werden gerade Zeugen einer Tragödie in Syrien. Hier geht es um viel mehr als nur um Geld, aber die Dringlichkeit schneller politischer Einflussnahme ist hier ebenfalls gegeben. Nicht umsonst werden kriegerische Konflikte mit Brandherden verglichen, die es schnell zu löschen gilt. Nervt die übliche Wahrung aller politischen Optionen der deutschen Bundesregierung bis zuletzt in anderen Angelegenheiten, ist sie hier kaum zu ertragen. Diese Option ist teuer erkauft.
Eine andere politische Option der Bundesregierung bezahlen wir nicht in Geld oder außenpolitischem Ansehen, sondern mit Risiko. Auf die Enthüllungen massiver Überwachungsprogramme der Briten und Amerikaner folgte von der Bundesregierung keine eindeutige Stellungnahme. Eine Teilnahme würde eine aktive Steuerung ermöglichen, eine entschiedene Ablehnung wäre die Voraussetzung für den Schutz der Bürger vor ausländischer Überwachung. Eine Haltung wurde jedoch nicht gefunden.
Hier zeigt sich die wirkliche Gefahr einer Multioptionsstrategie zur Wahrung des politischen Kapitals. Das Risiko massiver Überwachung macht sich im Alltag nicht bemerkbar. Meine Mails passieren unbemerkt den Filter und meine Facebook-Nachrichten werden auch nicht geöffnet, weil ich eben nicht ins Raster falle: Meine Daten sind zentral gespeichert, aber keiner greift sie ab. Die Art des Risikos liegt jedoch nicht in seiner alltäglichen Ausprägung, sondern in seinen Extrema: den extrem unwahrscheinlichen Ereignissen, den schwarzen Schwänen, vor denen Nassim Taleb zu warnen versuchte und durch die er so reich wurde. Unser schwarzer Schwan ist, dass uns die Kontrolle über diese Instrumente entgleitet. Das ist zugegebenermaßen extrem unwahrscheinlich, aber das sagte man auch über den Börsensturz 1987 und den 2001 und den 2008. Die eigenen Bürger vor diesem Risiko zu schützen, kostet politisches Kapital in Zeiten, in denen alles doch so einfach sein könnte.
Informationen durch die Komplexitätsreduktionswundermaschine gedreht zu bekommen, bis sie weich und kuschelig sind, bringt uns nichts. Wir brauchen keine Mutti, die unsere Entscheidungen trifft. Es wird Zeit, erwachsen zu werden. Es wird Zeit, Haltung zu zeigen.
Bald haben wir wieder die Wahl.